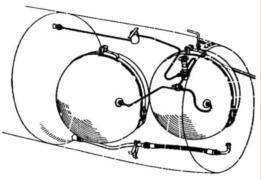Analytische Rekonstruktion:
Johannes Winkler HW2
Originalgetreuer Nachbau der Rakete von 1932
Am 6. Oktober 1932 explodierte die Höhenforschungsrakete
von Johannes Winkler beim Startversuch am Strand der Ostsee
nahe Pillau. Winkler hatte lange an dieser Rakete gerechnet
und konstruiert. Auf energisches Anraten seines Finanziers
Hugo Hückel war Winkler mit der HW2 von Dessau zum
Raketenflugplatz Berlin gezogen. Hier führte er abseits des
sonstigen Versuchsbetriebs der anderen Raketenpioniere seine
Vorversuche mit der HW2 (Hückel-Winkler No. 2) durch.
Die Höhenforschungsrakete war mit einem Luftdruck-
Registrierschreiber ausgerüstet. Bei einer Gesamtlänge von
190 cm wog die leere Rakte 10 kg.
Ein geplanter Start von der kleinen Insel Greifswalder Oie
nördlich von Peenemünde wurde durch die Behörden
untersagt. Wie schon zuvor bei der Startanfrage von Hermann
Oberth, musste eine mögliche Gefährdung des dortigen
Leuchtturms als Begründung herhalten.
Winkler und seine beiden Mitarbeiter Rof Engel und Hans
Bermüller erhielten aber die Erlaubnis, nahe Pillau einen Flug
durchzuführen. Nachdem einige Tage zuvor ein Startversuch
wegen undichter Leitungen abgebrochen wurde, war es am 6.
Oktober 1932 endlich soweit. Das Innere der Rakete war zum
Ausspülen von eventuell ausgetretenen Treibstoffgasen noch
schnell mit Stickstoff geflutet worden. Die Rakete sollte
theoretisch mit 32 kg Flüssigsauerstoff und 4 kg flüsigem
Methan betankt worden sein. Winkler gab das elektrische
Signal zum Öffnen der Ventile. Sofort explodierte eine
Gasmischung im Tankzwischenraum und vermutlich auch im
Triebwerk und schleuderte die Rakete mehrere Meter hoch in
die Luft. Die Außenhaut wurde zum großen Teil aufgerissen,
Tanks und Triebwerk blieben jedoch unbeschädigt.
Diese Komponenten sind bis heute im Original erhalten und
werden vom Deutschen Museum in München in der
Raumfahrtausstellung gezeigt.
Mangelde Versuchskultur Winklers
Über die Ursache der Explosion der HW2 wurde und wird viel
spekuliert. Winkler selbst schrieb: “… zeigte sich eine bei den
Prüfstandversuchen nicht vorhandene undichte Stelle, die erst
nach der Zündung erkennbar wurde, weil Brennstoff und
Sauerstoff in getrennten Behältern mitgeführt wurden, die nur
noch in dem Verbrennungszylinder zusammengeleitet werden.”
Seine beschwichtigende Behauptung, es sei nur eine kleine
Menge Knallgas explodiert, wie man sie auch im
Chemieunterricht zündet, wird durch Filmaufnahmen widerlegt.
Die betankte Rakete mit 46 kg Gewicht flog mehrere Meter
hoch in die Luft und einige Meter weit.
Rolf Engel machte später die Herangehensweise von Winkler
an Versuche verantwortlich für den Fehlschlag. Winkler habe
das Triebwerk der HW2 nur zweimal kurz auf dem
Raketenflugplatz gezündet. Winkler sei immer der festen
Überzeugung gewesen, wenn seine theoretischen
Überlegungen stimmen, würden die entsprechend gebauten
Geräte auch einwandfrei funktionieren.
In Berlin machte sich Dipl.-Ing. Klaus Schlingmann seit 2016
an einen Nachbau der HW2. Lange Recherchen sind diesem
Vorhaben vorangegangen. Die besondere Herangehensweise
von Klaus Schlingmann, von ihm “Analytische Rekonstruktion”
genannt, unterscheidet sich von anderen Nachbau-Vorhaben
zu Objekten der Luft- und Raumfahrtgeschichte.
Nicht nur die Formgebung eines Objektes wird von ihm
eingehend untersucht, sondern auch die originalen Materialien
und Herstellungsverfahren werden benutzt. Dadurch erhält
Klaus Schlingmann Dublikate, an denen der historische
Schaffensprozeß deutlich wird und die einen Einblick in die
Planung und Zielrichtung der Originale erlauben. Bei etlichen
wichtigen Originalen ist die Frage “warum hat man dies
damals genau so gebaut?” aus mit der Sichtweise der
heutigen Herstellungstechniken nicht zu beantworten. Die
Analytische Rekonstruktion gewährt daher Einblicke, die
anders nicht mehr zu gewinnen sind.
Für die HW2 heißt die Erkenntnis von Klaus Schlingmann,
dass mit höchster Wahrscheinlichkeit die Ventile für die
Gasansammlung innerhalb der Rakete verantwortlich sind.
Die von Johannes Winkler gewählte Ausführung der Ventile
konnte bei den hochgekühlten, verflüssigten Gasen
Sauerstoff (Siedepunkt -183 Grad Celsius) und Methan
(Siedepunkt -162 Grad C) keinen Dichtsitz garantieren.
Bei den Teststandversuchen in Berlin hatte Winkler die
Außenhaut der Rakete nicht montiert. Leckgase konnten sich
so nicht sammeln. Hier kommt wieder die ungenügende
Versuchskultur von Winkler ins Spiel. Auch aus seinem
Fehlschlag haben andere Raketenpioniere gelernt, dass jede
Komponente einer Rakete wiederholt unter wirklichkeits-
nahen Bedingungen getestet werden muss. Schließlich ist es
unbedingt notwendig eine Rakete als Gesamtsystem
durchzuprüfen, bevor an einen Startversuch gegangen
werden kann. Uwe W. Jack
Johannes Winkler mit der unverkleideten
HW2, so wird sie heute im Deutschen
Museum ausgestellt.
Winkler beobachtet in Berlin einen
Durchblasversuch mit der HW2 (kein
Brennversuch!)
Über der Holzform wird eine Kalotte für die Tanks gedrückt.
Oben: Der Sauerstofftank wird aus zwei Kalotten und dem
Zylinderstück zuerst mit Schweißpunkten geheftet.
Rechts: danach wird der Tank nach dem zeitgenössischen
Verfahren vollständig verschweißt - hier der Methantank.
Johannes Winkler in seiner Baracke auf dem Raketen-
flugplatz Berlin mit der Höhenforschungsrakete HW2. In
der Öffnung sind die beiden Manometer für den
Treibstoffdruck zu sehen.



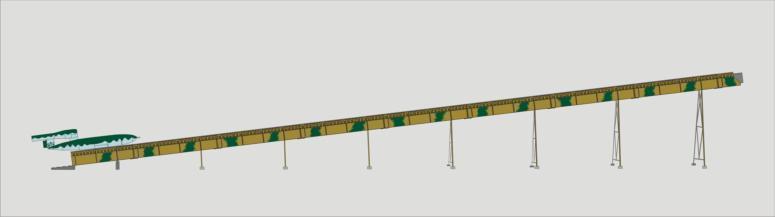


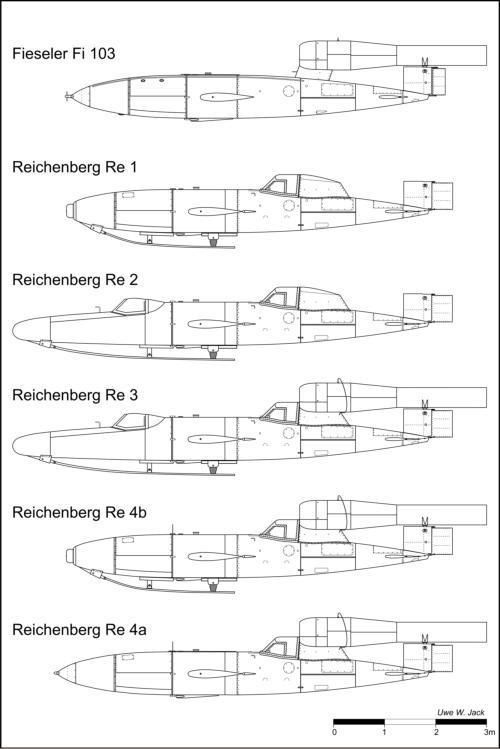


Die beiden vollständig nachgebauten Tanks der Winkler HW2.
Links der Sauerstoff-, rechts der Methantank.
Im Vergleich dazu im Bild rechts der originale Sauerstofftank. Die
originalen Tanks und Leitungen wurden vollständig mit Silberfarbe
gestrichen und sind über die Jahrzehnte verschmutzt. Daher das
unterschiedliche äußere Erscheinungsbild.


Unten: Ein Detail des Tanknachbaus
zeigt die originalgetreue Schweißtechnik



Rechts: Die beiden neu gefertigten Tanks
der HW2 in der Anordnung, wie sie in der
Rakete verbaut wurden.
Ganz rechts die Tanks in einer zeit-
genössischen Darstellung.
Ein originalgetreuer Nachbau der HW2
Nachdem einmal der Entschluss zum Nachbau der Winkler
HW2 gefasst war, stellte sich gleich die Frage der Zielsetzung.
Sollte sie zum Fliegen gebracht werden oder sollte es eine
vollständige, möglichst authentische Rekonstruktion sein?
Die HW2 zum Fliegen zu bringen würde eine umfangreiche
Modifizierung gegenüber dem Original bedeuten. Außerdem
gibt es außer ein paar Handskizzen keine original bemaßten
Fertigungszeichnungen des Triebwerks. Es läuft also von "so
könnte es etwa gewesen sein" auf eine nicht seriöse
Behauptung ohne Belege: "so war das Original" hinaus.
Da die Ursache des Startversagens in Form einer Explosion
bekannt ist (Undichtigkeit der Hauptventile führten zur
Knallgasbildung), gibt es nichts, was man nicht auf dem
Teststand nachweisen könnte, hatte die HW2 doch schon unter
Winkler ihre Funktionsfähigkeit auf dem Prüfstand auf dem
Raketenflugplatz Berlin bewiesen.
Eine so modifizierte und fliegende HW2 sieht zwar auf dem
ersten Blick aus wie eine HW2, ist aber keine. Die
Entscheidung zum Bau einer möglichst authentischen,
eigentlich funktionsfähigen HW2 mit Außenhaut und
Startgestell, so wie sie am 6. Oktober 1932 an der
Kurischen Nehrung an den Start gebracht wurde, stand sehr
schnell fest. Unsere Zielsetzung ist der exakte Nachbau der
HW2 um den Entwicklungsweg, den Bau, die damit
verbundenen Probleme und deren Lösung zu verstehen und
zu dokumentieren.
Letztlich steht so neben dem originalen Exponat HW2 im
Deutschen Museum ein weiteres HW2 Exponat nebst
Startgestell der AG Daedalus Raketenflugplatz-Berlin dem
interessierten Betrachter zur Verfügung.
Da das Projekt nicht zu unseren Hauptvorhaben zählt und
auch privat finanziert werden muss, wird sich die
Fertigstellung über einen längeren Zeitraum hinziehen.
Dipl.-Ing. Klaus Schlingmann

Oben:
Für jedes Detail sind aufwendige Recherchen notwendig.
Hier für die Erstellung der Holzform für die Tank-Kalotten.
Rechts:
Klaus Schlingmann beim Drechseln der hölzernen
Halbkugel-Form für die Tanks der HW2.

Die Tanks müssen mit den entsprechenden Öffnungen
zur Aufnahme der Anschlüse versehen werden.

Oben links: Das Entlüftungsventil der originalen
HW2 von 1932.
Links: Nachgefertigte Entlüftungsventile.
Oben: Die Oberseite des Sauerstofftanks mit
montiertem Befüllstutzen und Entlüftungsventilen.